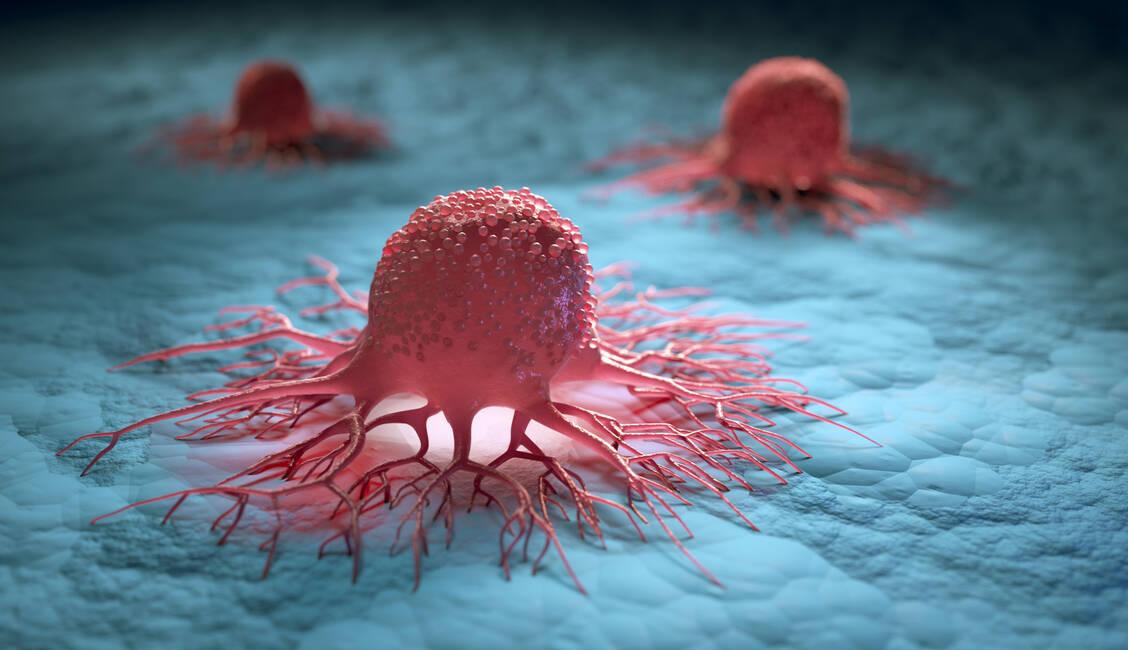Deutlich kritischer äußert sich dagegen Professorin Dr. Dorothy Bennett, Director of the Molecular and Clinical Sciences Research Institute der University of London ,beim »Science Media Centre«. Zwar hält auch sie die Studie von Gu und Kollegen für interessant, da sie einen relativ neuen Ansatz zur gezielten Bekämpfung von Krebszellen untersucht. Sie zeigt sich aber enttäuscht, dass die Behauptung, der Anti-PCNA-Wirkstoff würde »Krebszellen abtöten«, nur begrenzt zutreffe. Denn Daten, aus denen die Tötungsraten von Zellen beziehungsweise der Verlust der Koloniebildung, also der Teilungsfähigkeit hervorgingen, würden nur für drei menschliche Neuroblastomlinien vorgelegt. Diese zeigten zudem, dass nur einige und keinesfalls alle Zellen pro Kultur abgetötet würden.