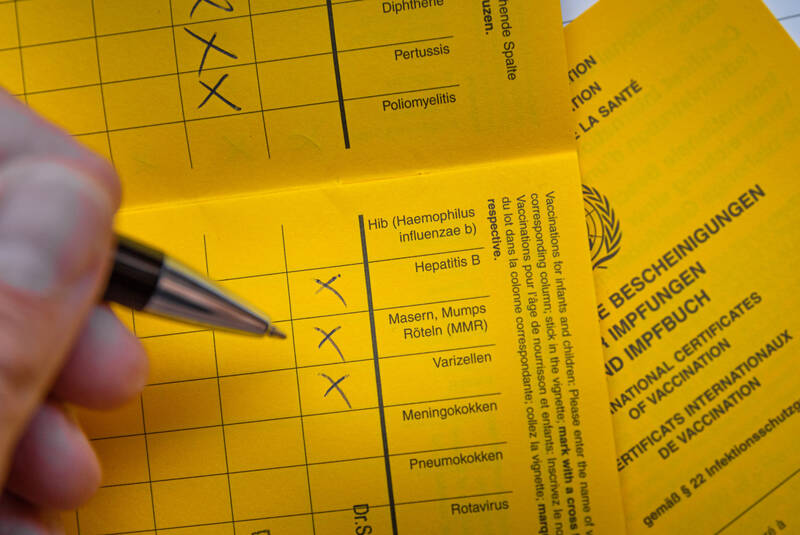|
Krankheit (Erreger)
|
Übertragung
|
Mögliche Schädigung
|
Prophylaxe
|
Therapie
|
Stillen bei Infektion
|
|
Hepatitis B(Hepatitis-B-Virus)
|
Blut, Körpersekrete
|
lebenslange chronische Infektion des Kindes
|
Impfungunmittelbare postnatale Impfung und Immunglobulingabe bei Kindern von HBsAg-positiven Müttern
|
off Label: antivirale Therapie (Nukleosid-/Nukleotid-Analoga)
|
Eine HBsAg-positive Mutter sollte stillen, außer bei bestehender HBV/HIV-Koinfektion Voraussetzung: Aktiv-/Passivimmunisierung des Neugeborenen innerhalb von zwölf Stunden nach der Geburt
|
|
Hepatitis C(Hepatitis-C-Virus)
|
über Blut, z. B. bei intravenösem Drogenkonsum,Geschlechtsverkehr
|
Chronifizierung und Entwicklung zu einer Leberzirrhose
|
keine Schutzimpfung verfügbarkeine etablierte, zugelassene antivirale Prophylaxe beim Neugeborenen verfügbarkeine Immunglobuline verfügbar
|
antivirale Kombinationstherapie in der Schwangerschaft kontraindiziert
|
HCV-infizierte Mütter sollen stillenAusnahmen: HCV/ HIV-Koinfektion, Risikokinder
|
|
Herpes labialis und/oder genitalis (Herpes-simplex-Virus Typ 1, -2)
|
Speichel, Schleimhaut- und Hautkontakt, Genitalsekrete, Geschlechtsverkehr
|
kongenitale HSV-Infektion, Herpes neonatorum
|
keine Impfung oder passive Immunisierung verfügbar
|
antivirale Therapie der Schwangeren bei Primärinfektion (off Label)antivirale Therapie des Neugeborenen (Aciclovir)
|
keine Einschränkung des Stillens, keine Übertragung durch Muttermilch bei Herpesläsionen an der Brustwarze: Kind nicht über die betroffene Brust stillen und Milch von der betroffenen Seite abpumpen und entsorgen
|
|
Masern(Morbilli, Masernvirus)
|
Tröpfcheninfektion,Kontakt mit infektiösen Sekreten
|
Fehl- und Frühgeburten,Masern beim Neugeborenen
|
Lebendimpfung, in der Schwangerschaft kontraindiziertbei Exposition ungeschützter Schwangerer: Gabe von Standard-Immunglobulinpräparaten, kein spezifisches Immunglobulinpräparat verfügbar
|
symptomatische Therapieantivirale Therapie nicht verfügbar
|
MMR-Impfschutz möglichst noch im Wochenbett komplettieren, damit die Mutter kein Infektionsrisiko für das ungeschützte Baby istStillen ist keine Kontraindikation für eine MMR-Impfung
|
|
Ringelröteln(Parvovirus B 19)
|
Tröpfcheninfektion,Schmierinfektion durch Nasen-Rachensekret
|
Fruchttod oder Ergüsse in Körperhöhlen (Hydrops fetalis)
|
kein spezifisches Immunoglobulinpräparat verfügbar
|
intrauterine Erythrozytentransfusion bei fetaler Anämie oder Hydrops fetalis
|
Mütter mit akuter B19-Virusinfektion sollen stillen
|
|
Röteln, Rubella,(Rötelnvirus)
|
Tröpfcheninfektion
|
hohe Missbildungsrate
|
Lebendimpfung,in der Schwangerschaftkontraindiziert
|
symptomatische Therapieantivirale Therapie nicht verfügbar
|
akute postnatale Infektion: kein Stillverbot, keine Trennung von Mutter und Kind (Ausnahme Frühgeborene)
|
|
Virusgrippe(Influenza-Virus)
|
Tröpfcheninfektion und über Aerosole
|
schwererer Verlauf bei Schwangeren
|
Impfung der Mutter ab zweitem Trimenon: schützt die Frau und das Neugeborene vor schweren Verläufen
|
antivirale Therapie (Oseltamivir, off Label), symptomatische Therapie
|
hohes Infektionsrisiko beim Stillen bei Erkrankung der Mutter
|
|
Windpocken, Varizellen(Varicella-Zoster-Virus)
|
Tröpfcheninfektion,Schmierinfektion durch infektiösen Bläscheninhalt
|
evtl. Früh- oder Totgeburt, bei 1 bis 2 Prozent schwere Schäden
|
Varizellen: Lebendimpfstoff empfohlen, in der Schwangerschaft kontraindiziertZoster: Totimpfstoff, für Risikogruppen empfohlen, für Schwangerschaft nicht relevant
|
passive Immunisierung mit Varizella-Zoster-Immunglobulinantivirale Therapie (Aciclovir)
|
Trennung von Mutter und Kind als individuelle Entscheidung. Infektiöses Virus wurde bislang nicht in der Muttermilch nachgewiesen eine an Zoster erkrankte Mutter darf stillenCave: Wegen der hohen Infektiosität der Varizellen wird die Mutter ihr Neugeborenes mit hoher Wahrscheinlichkeit anstecken.
|
|
Zikafieber (Zikavirus)
|
infizierte Moskitos
|
schwere Komplikationen, intrauteriner Fruchttod
|
keine aktive oder passive Immunisierung verfügbar (in klinischer Prüfung: inaktivierter bzw. attenuierter Impfstoff)
|
keine Therapie verfügbar
|
Infektion durch Muttermilch ist nicht nachgewiesen, kein Stillverbot
|
|
Zytomegalie(Zytomegalievirus)
|
Schmierinfektion, Ausscheidung des Virus in Speichel, Stuhl und Urin
|
häufigste Infektion in der Schwangerschaftkindliche Missbildungen selten, vor allem bei Erstinfektionen der Mutter
|
Valaciclovir zeigte in Studien therapeutische und prophylaktische Effekte
|
antivirale Therapie mit Ganciclovir, Valganciclovir (off Label)
|
kongenital infizierte Neugeborene dürfen gestillt werden
|