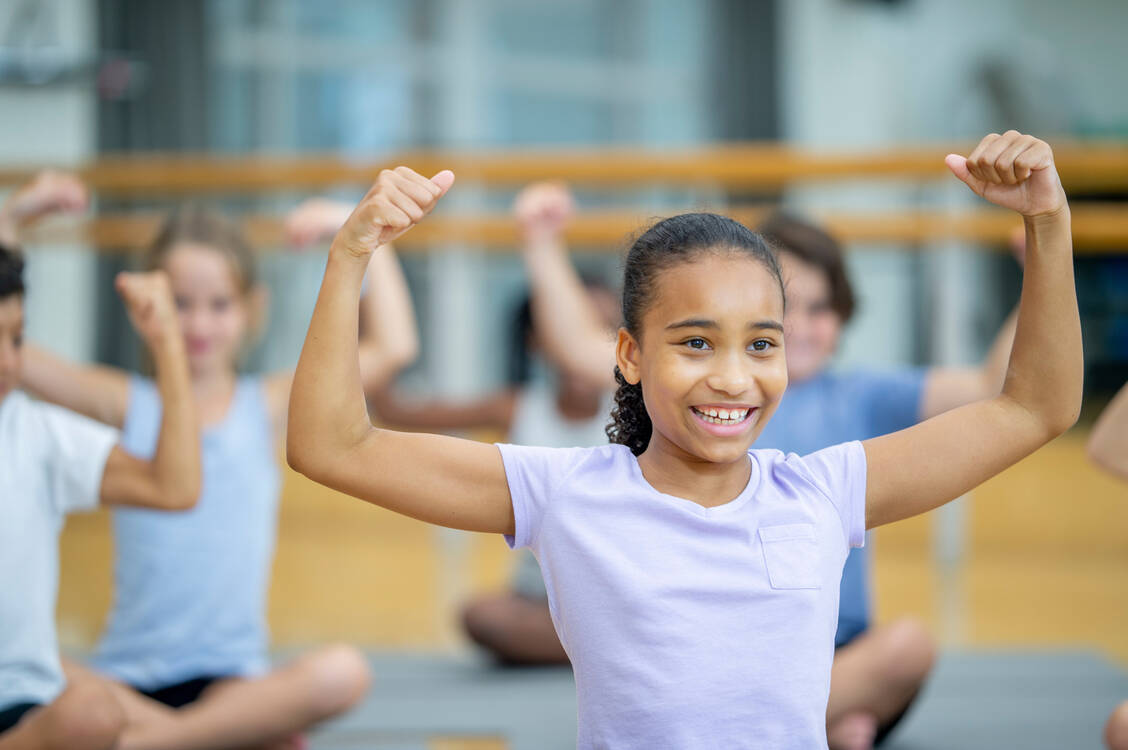Bis es hierfür Lösungen gibt, bleibt Patienten wohl nur, auf natürliche Weise die Myokin-Spiegel in ihrem Körper zu erhöhen, indem sie sich körperlich anstrengen. Grundsätzlich wirkt jede Art der Bewegung dem Abbau von Muskulatur und dem Aufbau von Fettgewebe entgegen. Die Effekte können den Verlauf vieler Krankheiten positiv beeinflussen und daher stellt Bewegung schon längst bei vielen, vor allem chronischen Krankheiten eine Säule der Behandlung dar. Es sind jedoch noch mehr Erkenntnisse dazu erforderlich, welche Art der körperlichen Aktivität in welcher Intensität jeweils optimal ist.
Myokine werden nicht gleichermaßen bei jeder Sportart ausgeschüttet. Einige produziert der Körper verstärkt bei Krafttraining, andere eher bei Ausdauertraining. Bei schwerem Krafttraining beispielweise wird die Proteinsynthese besonders stark angeregt. Hierbei sind die Myokine Myostatin, Folstatin und Decorin involviert. Beim Kraftausdauertraining, also dem Bewegen von leichteren Gewichten mit vielen Wiederholungen, bilden sich vor allem BDNF, Irisin und IL-6. Zudem ist ein individuell unterschiedlicher Schwellenwert zu beachten. Wer es mit dem Sport übertreibt, kann in einen Übertrainingszustand geraten, der proinflammatorisch wirkt.