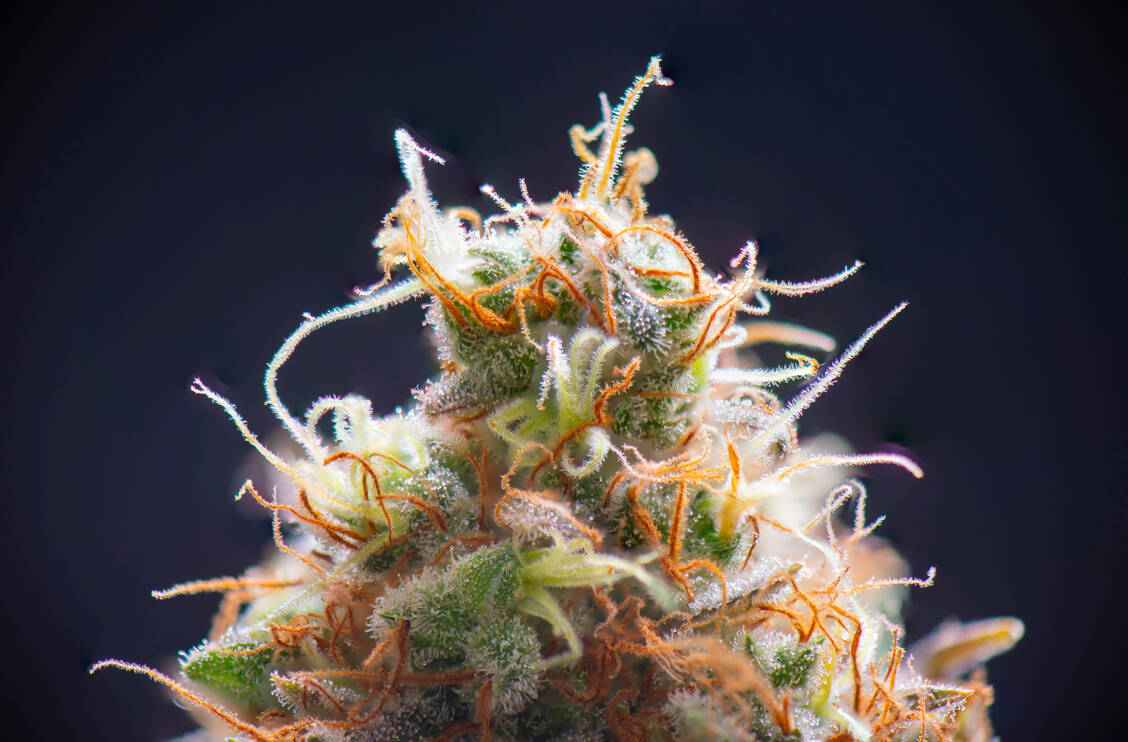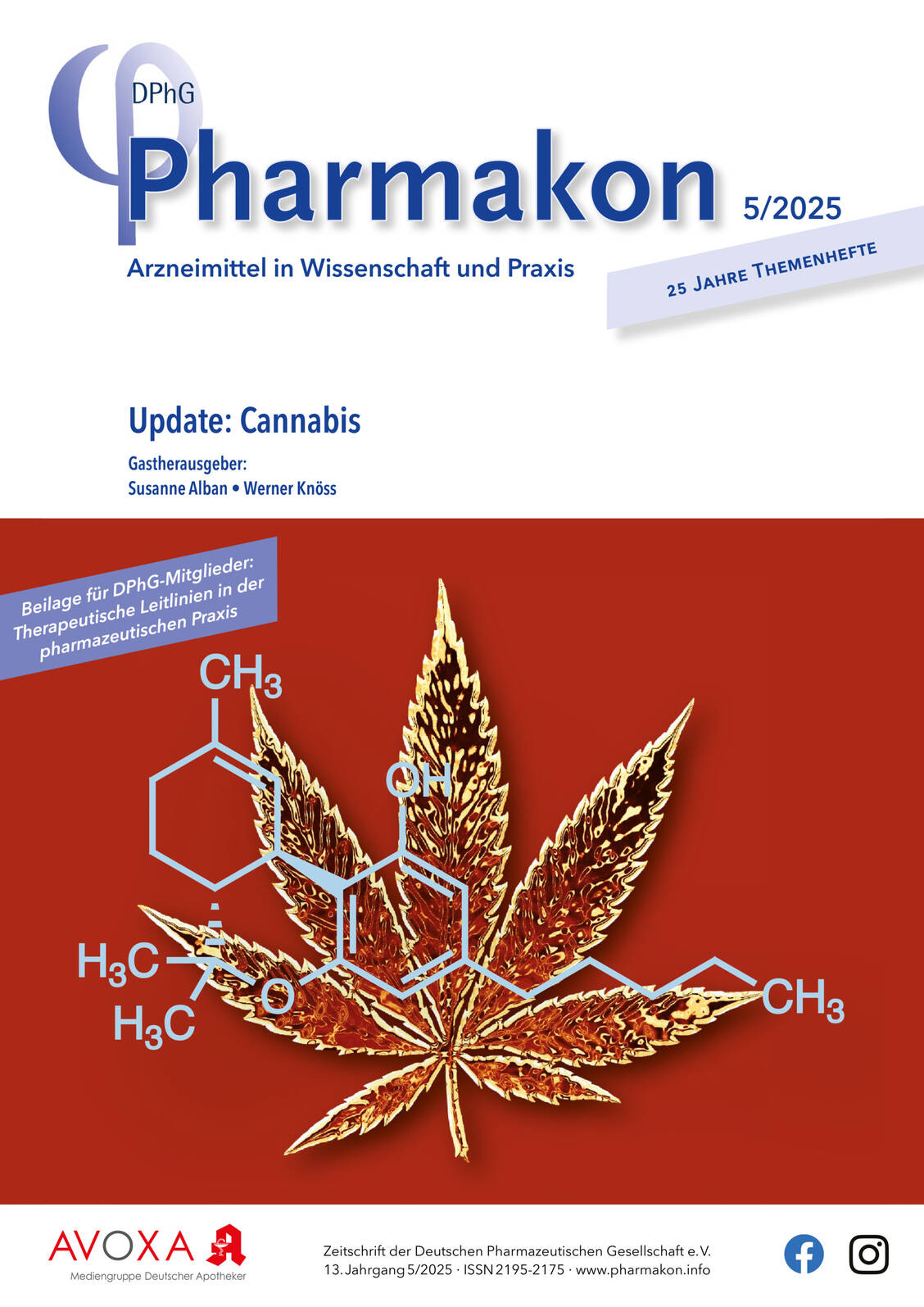Die natürlichen Liganden von CB1 und CB2 sind die Endocannabinoide Anandamid und 2-Arachidonoylglycerol. Sie wirken als Vollagonisten. THC und sein halbsynthetisches, chemisch identisches Pendant Dronabinol sind dagegen Teilagonisten am CB1 mit längerer Halbwertszeit, leicht abweichender Rezeptorbindung und unterschiedlicher Signaltransduktion. Zudem bindet THC an CB2 in Immunzellen. THC wirkt psychotrop, analgetisch (besonders bei chronischen und neuropathischen Schmerzen), antiemetisch, appetitanregend, antikonvulsiv (vor allem in Kombination mit CBD), sedativ, anxiolytisch, euphorisierend und antiphlogistisch. Dementsprechend wird THC/Dronabinol angewendet bei Chemotherapie-induzierter Übelkeit und Erbrechen, Appetitverlust/Kachexie, Schmerzen und Spastik