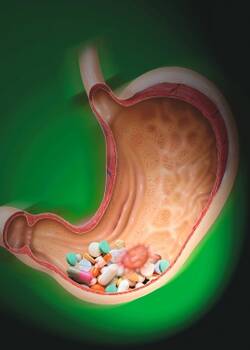Am Beispiel der Calciumantagonisten aus der Gruppe der Dihydropyridine machte der Professor für Biopharmazie deutlich, warum zum Beispiel das schnelle Anfluten von Nifedipin nicht erwünscht ist. »Der daraus resultierende schnelle Blutdruckabfall kann eine reflektorische Tachykardie bedingen«, erklärte Weitschies. Daher gebe es so viele retardierte Nifedipin-Präparate. Im Falle eines anderen Vertreters der Dihydropyridine, Felodipin, gebe es sogar nur Retardarzneiformen auf dem Markt.
Weitschies warnte vor den sogenannten Food-Effekten dieser retardierten Formen. Demnach kann die Retention der Retardform durch Nahrung eine Akkumulation von freigesetztem Wirkstoff im Magen bewirken und den Effekt der Retardierung aufheben. »Vorsicht bei der Einnahme retardierter Präparate mit den Mahlzeiten.« Einige Stunden danach komme es nämlich zu deutlich überschießenden Effekten, die fast einem sogenannten Dose Dumping (plötzliche Freisetzung der gesamten Wirkstoffmenge) gleichkommen. Weitschies riet deshalb, retardierte Nifedipin-Felodipin-Präparate immer 30 Minuten vor dem Frühstück einzunehmen.
Von einem dritten Dihydropyridin, Amlodipin, gibt es im Gegensatz zu Nifedipin und Felodipin überhaupt keine Retardpräparate. »Amlodipin retardiert sich selbst«, begründete der Apotheker. Der Wirkstoff flute extrem langsam an, maximale Plasmaspiegel würden erst nach sieben bis neun Stunden erreicht.
Die Vermeidung von Plasmaspiegelfluktuationen spielt zum Beispiel bei Antiepileptika eine Rolle. »ZNS-relevante Nebenwirkungen von Valproinsäure können durch die Umstellung auf retardierte Präparate reduziert werden«, nannte Weitschies ein Beispiel. In diesem Zusammenhang ging der Apotheker auch auf die Aut-idem-Fähigkeit retardierter Antiepileptika ein. Seiner Meinung nach ist diese nicht gegeben und es kommt – teilweise mit einiger Verzögerung – zu neuen Anfällen. Die Diskussion »Originalprodukt versus Generikum« hält er für unsinnig. Das Problem sei die wahllose Substitution (zum Beispiel im Rahmen der Rabattverträge) bei Patienten, die bereits auf ein Mittel, egal ob Original oder Generikum, gut eingestellt sind.