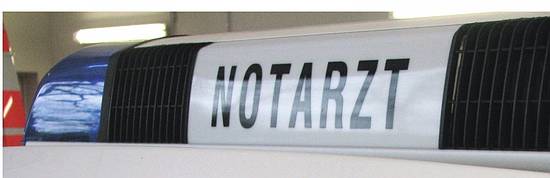»Die Zahl der Koronartoten in der westlichen Welt hat sich zwischen den 1970er-Jahren und der Jahrtausendwende nahezu halbiert.« Diese positive Nachricht stellte Professor Dr. Heinz Völler, leitender Kardiologe im Reha-Zentrum »Klinik am See« in Rüdersdorf, an den Beginn seines Vortrags. Er führte diese Entwicklung vor allem auf die bessere Arzneimittelversorgung von Patienten mit koronaren Erkrankungen zurück. »Allerdings dürfen wir uns auf dem Erfolg nicht ausruhen«, sagte er. Denn ungefähr seit dem Jahr 2000 steige die Zahl der tödlichen Herzinfarkte wieder, sicherlich im Zusammenhang mit der Zunahme des Übergewichts.
Völler appellierte an jeden Einzelnen, sein Herz-Kreislauf-Risiko durch einen gesunden Lebensstil so gering wie möglich zu halten und bei Verdacht auf einen Infarkt nicht allzu lange zu warten. Denn in den ersten anderthalb Stunden sei die Schädigung des Herzmuskelgewebes meist noch relativ gering. Sein Rat: »Lieber einmal zu oft in die Notaufnahme als einmal zu spät.« Als typische Warnhinweise nannte er heftige, mitunter in die Umgebung ausstrahlende Schmerzen oder Engegefühl in der Brust, Atemnot, Übelkeit und Brechreiz. Die letzten beiden, leider nicht besonders auffälligen Symptome träten besonders häufig bei Frauen auf.
Die Diagnostik stütze sich vor allem auf das Elektrokardiogramm (EKG), möglicherweise ergänzt durch einen Herz-Ultraschall, eine Herzkatheter-Untersuchung sowie die Bestimmung von Biomarkern im Blut, die beim Abbau von Herzmuskelgewebe ansteigen. »Besonders aussagekräftig ist dabei Troponin«, sagte Völler. Anhand des EKG-Befunds unterschied er grundsätzlich zwischen einem ST-Hebungs-Infarkt (STEMI) und einem Nicht-ST-Hebungs-Infarkt (NSTEMI). Letzterer umfasst die eher milden Formen sowie die instabile Angina Pectoris. »Beim STEMI ist die Lage noch bedrohlicher und erfordert unverzügliches Handeln.«
Die Therapie bei STEMI und NSTEMI besteht darin, den gestörten Blutstrom in den Herzkranzgefäßen wieder in Gang zu setzen. Grundsätzlich eignen sich dazu eine Lyse mit fibrinolytischen Medikamenten wie Streptokinase oder Alteplase, eine Bypass-Operation sowie eine Ballondilatation mithilfe eines Katheters (auch als perkutane Koronarintervention bezeichnet). Bei Letzterer bekommen viele Patienten zusätzlich röhrenförmige Gefäßstützen (Stents) mit oder ohne Medikamentenbeschichtung eingesetzt, um eine erneute Verengung der Gefäße zu verhindern. Die Ballondilatation nimmt Völler zufolge inzwischen eine herausragende Stellung ein und hat die Lyse-Therapie fast vollkommen ersetzt. Doch ließen sich beide Verfahren auch kombinieren. Zusätzlich verwendeten Ärzte in der Akuttherapie antithrombozytäre Medikamente (Acetylsalicylsäure, Clopidogrel, Prasugrel sowie GPIIb/IIIa-Hemmer) und Antikoagulanzien (Heparin, Enoxaparin, Bivalirudin). Bei der Auswahl spiele die Art des Infarkts und die ausgewählte koronare Therapie eine Rolle.