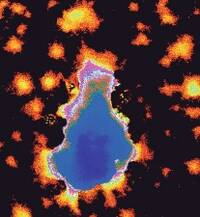Eine andere Möglichkeit, die Thrombozytenaggregation zu hemmen, bieten GPIIb/IIIa-Inhibitoren. Dazu gehören Abciximab, Tirofiban und Eptifibatid. »Ihr Einsatz beschränkt sich aber vor allem auf die Anwendung im Krankenhaus«, sagte Alban. Alle drei hemmen kompetitiv die Bindung von Fibrinogen, von-Willebrand-Faktor und adhäsiver Proteine an das aktivierte Integrin αIIbβ3 (GPIIb/IIIa). Damit verhindern sie zum einen die Bildung loser Thrombozyten-Aggregate und zum anderen die Stabilisierung des Aggregats durch Fixierung loser Fibrinogen-Brücken.
Die Hemmung des Thrombin-Rezeptors PAR-1 auf Thrombozyten stellt eine neue Strategie zur Plättchenhemmung dar. Alban informierte, dass sich mit dem selektiven, nicht peptidischen, reversiblen PAR-1-Antagonisten SCH 530348 ein potenzieller neuer Arzneistoffkandidat in der klinischen Entwicklung befindet. Der Himbacin-basierte Wirkstoff, der aus der Rinde von Galbulimima baccata extrahiert wurde, befindet sich derzeit in Studien der Phase-III.
Als dritte Arzneistoffklasse, die beim ACS zum Einsatz kommt, stellte Alban die Antikoagulanzien vor. Eine Zulassung bei ACS besitzen unfraktioniertes Heparin, das niedermolekulare Heparin Enoxaparin, das synthetische Pentasaccharid Fondaparinux und das synthetische Hirudin-Analogon Bivalirudin. Die ersten beiden Vertreter bezeichnete Alban als multivalente Biomodulatoren (unter anderem indirekte Faktor-Xa- und Thrombinhemmung), die anderen beiden als selektive Inhibitoren. So ermögliche Fondaparinux eine selektive indirekte Faktor-Xa-Hemmung und Bivalirudin eine selektive direkte Thrombinhemmung. Das erkläre auch, warum derzeit die direkten Faktor-Xa-Hemmer Rivaroxaban und Otamixaban sowie der direkte Thrombinhemmer Dabigatranetexilat in der Therapie des ACS untersucht werden.