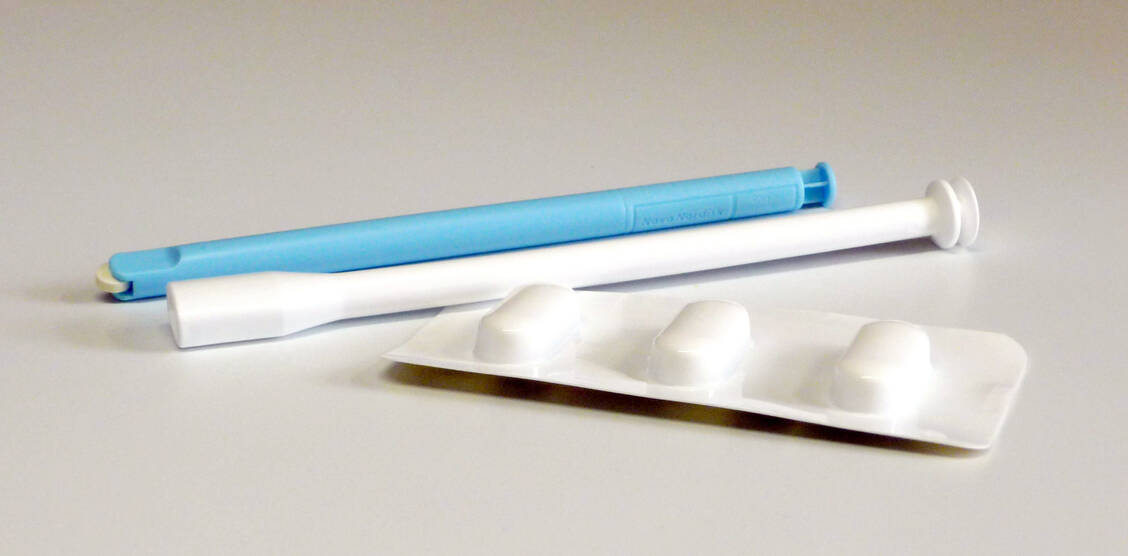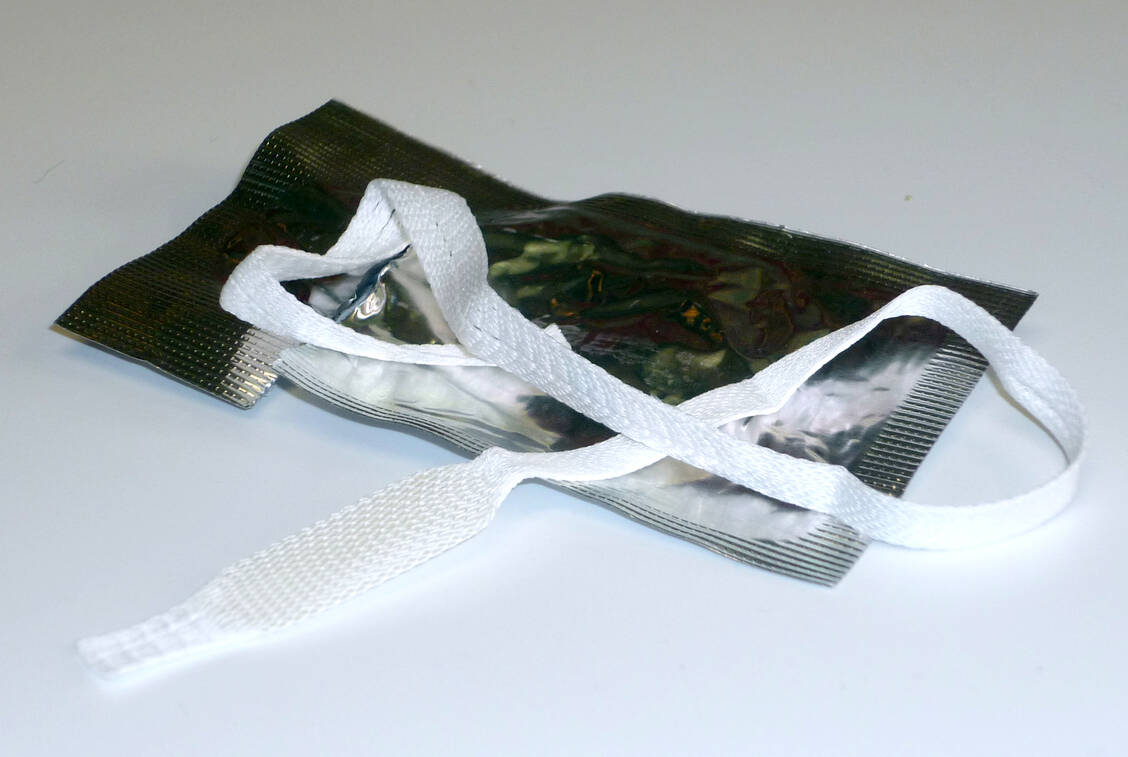Eine angemessene Pflege schützt vor Infektionen im Intimbereich. Allerdings schadet übertriebene Intimpflege mehr als sie nützt, denn grundsätzlich ist die Scheide selbstreinigend. Das Vaginalsekret wirkt antimikrobiell und befördert auch Krankheitserreger aus der Scheide. Eine Reinigung betrifft daher ausschließlich den äußeren Bereich, also die Schamlippen, aber nicht den Scheideneingang oder gar die Vagina. Am besten werden dabei lediglich lauwarmes Wasser und die Hände benutzt, um Smegma zu entfernen, das sich aus Talgabsonderungen, abgestorbenen Hautzellen sowie Urin- und (gegebenenfalls) Spermarückständen zusammensetzt. Waschlappen sind nach der Verwendung hygienisch zu reinigen oder es werden am besten gleich Einmalwaschlappen verwendet. Seifen, Duschgels oder Intimwaschprodukte dürfen, wenn überhaupt, nur äußerlich angewandt werden und sollen den physiologischen pH-Wert nicht stören.
Die Reinigung reicht einmal täglich. Nach dem Geschlechtsverkehr oder nach dem Sport ist eine erneute Pflege sinnvoll.
Scheidenspülungen, die eine Reinigung von innen versprechen, sind kontraproduktiv, da sie das natürliche Gleichgewicht stören und dadurch die physiologische Abwehrkraft schwächen. Duftstoffe oder Intimsprays dienen nicht der Intimpflege und sind zur Gesundheitsvorsorge nicht geeignet.
Auch wenn sich in der Schwangerschaft der pH-Wert der Scheide erhöht und Bakterien es leichter haben, sich anzusiedeln, dürfen schwangere Frauen die Pflege nicht übertreiben. Reiben und Rubbeln sind absolut tabu. Stattdessen gilt auch in der Schwangerschaft, dass einmal täglich warmes Wasser in der Regel ausreicht.