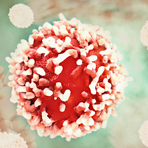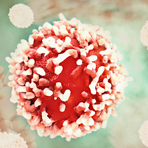
Da Krebszellen teilweise einen stark erhöhten Bedarf an Glutamin haben, könnte es eine Therapieoption darstellen, Tumoren von der Zufuhr dieser Aminosäure abzuschneiden. Gegen diesen Ansatz sprechen sich im «EMBO Journal» jetzt aber die Arbeitsgruppen um Professor Dr. Martin Eilers vom Biozentrum der Universität Würzburg und Dr. Stefan Kempa vom Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in Berlin aus. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass ein Glutamin-Entzug Krebszellen zwar bremst, sie aber nicht abtötet, was zu einem hohen Rückfallrisiko führen würde.
Wie einer Pressemitteilung der Universität Würzburg zu entnehmen ist, hat man die Glutamin-Sucht von Krebszellen bisher meist in Zellkulturen untersucht, die den Transkriptionsfaktor c-MYC überexprimieren. Dieser wichtige Regulator des Zellwachstums und der Zellteilung ist bei Krebs oft außer Kontrolle geraten. In den untersuchten – allerdings genetisch manipulierten – Zellkulturen starben die Krebszellen tatsächlich ab, wenn man ihnen das Glutamin nahm.
Die Ernüchterung folgte, als die Forscher eine Linie von Darmkrebszellen untersuchten, in denen c-MYC von Natur aus überexprimiert war. Ein Glutamin-Entzug bedeutete für diese Zellen nicht den Tod. Sie legten nur eine Teilungspause ein, aus der sie wieder in den Wachstumszustand zurückkehren konnten.
Der Grund für dieses unterschiedliche Verhalten könnte sein, dass sich die Art und Weise der Regulation der c-MYC-Produktion unterscheidet. «Im genetisch veränderten Zellkultursystem bleibt c-MYC immer auf einem hohen Level, während es bei den natürlichen Darmkrebszellen herunterreguliert wird, sobald Glutamin knapp wird», erklärt Eilers. Das könne bedeuten, dass c-MYC beim Abtöten der Zellen eine Rolle spielt.
Wie kann man sich das erklären? Dazu muss man sich zunächst anschauen, wie c-MYC durch Glutamin reguliert wird. Die Aminosäure wird in Zellen zur Produktion von Nukleotiden benötigt. Wenig Glutamin bedeutet wenig Nukleotide. Das wiederum bewirkt, dass auch der c-MYC-Spiegel sinkt. In der Folge kann der Transkriptionsfaktor seine Aufgabe, die Steuerung der Aktivität vieler Gene, nicht mehr erfüllen. «Unsere Ergebnisse legen nahe, dass c-MYC die Verfügbarkeit von Nukleotiden mit der Transkription koppelt», erklärt Kempa. Das sei äußerst sinnvoll. Die Zelle versuche gar nicht erst, RNA zu produzieren, wenn die Grundbausteine dafür fehlen.
Diese Kopplung funktioniert aber nicht in Zellen, denen die erhöhte c-MYC-Konzentration durch genetische Veränderungen von außen aufgezwungen wurde. In ihnen läuft die Transkriptionsmaschinerie auch bei Glutamin-Entzug einfach weiter, selbst wenn zu wenige Nukleotide vorhanden sind. Das kann zu Fehlern führen, die für die Zelle letztlich tödlich sind. «Die Glutamin-Sucht von Krebszellen wurde vorwiegend in solchen Zellkultursystemen analysiert. Darum hat man das therapeutische Potenzial des Glutamin-Entzugs bisher vermutlich falsch bewertet», so Eilers. (ss)
DOI: 10.15252/embj.201796662
Mehr zum Thema Krebs und Zytostatika
13.04.2017 l PZ
Foto: Fotolia/crevis