
Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Hirnblutungen: Blutverdünner neutralisieren, Blutdruck senken |
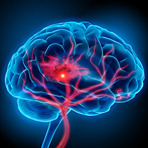
In einer groß angelegten Studie haben deutsche Forscher untersucht, wie sie am besten bei Patienten mit Hirnblutungen vorgehen, die Blutverdünner einnehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie leitet daraus neue Therapieempfehlungen ab. Demnach sollten im Fall von Hirnblutungen Gerinnungshemmer wie Phenprocoumon (Marcumar® und andere) schnellstmöglich neutralisiert werden. Wenn es gelang, den INR-Wert binnen vier Stunden nach der Einweisung unter 1,3 zu senken, traten nur bei 19,8 Prozent der Patienten eine Vergrößerung des Hämatoms auf. Bei einem INR über 1,3 weitete sich die Blutung bei 41,5 Prozent aus.
Für die retrospektive Studie, die heute im Fachjournal «JAMA» erschienen ist, werteten Forscher von 19 deutschen Unikliniken und Krankenhäusern die Daten von 1200 Schlaganfallpatienten aus, die zuvor mit Blutverdünnern behandelt worden waren und eine Hirnblutung erlitten hatten. Auch von einer Blutdrucksenkung bei Einweisung profitierten die Patienten. Wurde die Blutverdünnung neutralisiert und der systolische Blutdruck unter 160 mmHg gesenkt, lag die Sterblichkeit bei 13,5 Prozent gegenüber 20,7 Prozent, wenn beide Ziele verfehlt wurden, berichtet die DGN.
Die Forscher konnten aus ihren Daten auch ableiten, dass die weitere Einnahme von Blutverdünnern das Risiko für weitere Schlaganfälle und Hirnblutungen nicht erhöht, sondern in Bezug auf ischämische Komplikationen von 15 auf 5,2 Prozent sogar senkte.
„Die Wiederaufnahme der Blutverdünnung zeigte einen klaren Schutz vor Schlaganfällen, ohne dass wir in unserer Patientenkohorte gleichzeitig ein vermehrtes Auftreten der gefürchteten Hirnblutung beobachteten“, kommentiert Studienleiter Professor Dr. Hagen Huttner von der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen. „Somit ergibt sich ein Netto-Nutzen zugunsten der Wiederaufnahme der Blutverdünnung.“ In Deutschland müssen nach Schätzung der DGN annähernd eine Million Menschen Antikoagulanzien einnehmen.
An der Uniklinik in Essen wollen Neurologen nun in einer prospektiven Studie an 100 Patienten mit Vorhofflimmern und intrakranieller Blutung untersuchen, welche Patienten wieder antikoaguliert werden müssen und wie sich die neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK) von Phenprocoumon unterscheiden. Für NOAKs gibt es im Gegensatz zu den altbekannten Vitamin-K-Antagonisten noch keine Antidota. Es befinden sich jedoch einige Kandidaten in der klinischen Entwicklung. (dh)
DOI:10.1001/jama.2015.0846
Mehr zum Thema Herz-Kreislauf
25.02.2015 l PZ
Foto: Fotolia/psdesign1