
Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Diabetes: Auf den postprandialen Wert achten! |
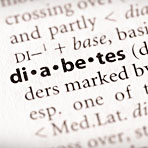
Die Messung des Langzeitblutzuckers HbA1C reicht zur Früherkennung eines Diabetes mellitus nicht aus. Aussagekräftiger sei der postprandiale Blutzuckerwert, sagte Dr. Christoph Neumann, München, beim Kongress «Diabetologie grenzenlos» in München.
Der HbA1C-Wert kann trügen. Bereits bei einem Wert unter 6,5 Prozent könne der Glucosestoffwechsel gestört sein und sogar Patienten mit manifestem Diabetes könnten normal niedrige Werte haben, sagte der niedergelassene Diabetologe. Das kardiovaskuläre Risiko steigt aber nicht erst bei einem manifesten Diabetes, sondern schon im Stadium der gestörten Glucosetoleranz. Da die postprandiale Hyperglykämie sehr früh im Krankheitsverlauf auftritt, empfahl Neumann, den Blutzucker nicht nüchtern, sondern nach dem Essen oder noch besser nach einem oralen Glucosetoleranztest (oGTT) zu kontrollieren. Beim oGTT muss der Patient nach einer mindestens zehnstündigen Nahrungs- und Alkoholkarenz eine Lösung von 75 g Glucose in 250 bis 300 ml Wasser innerhalb von fünf Minuten trinken. Der Blutzucker wird zu Beginn und nach 120 Minuten gemessen. Gemäß der International Diabetes Federation (IDF) muss der Wert unter 160 mg/dl liegen.
Je niedriger der HbA1C-Wert ist, umso höher sei der prozentuale Beitrag des postprandialen Zuckerwerts, sagte Neumann. Bei einem Langzeitwert unter 7,3 Prozent mache die postprandiale Blutglucose etwa 70 Prozent aus. Bei hohen Langzeitwerten spiele dagegen der Nüchternblutzucker die Hauptrolle. In jedem Fall müssten zunächst die Nüchternwerte gesenkt werden; Ziel ist ein Wert unter 110 mg/dl. Dies gelinge mit Metformin, Pioglitazon (für Privatpatienten) und Insulingabe zur Nacht.
Neumann plädierte dringend dafür, erhöhte postprandiale Zuckerwerte zu behandeln – schon um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Die Patienten sollten nur drei Mahlzeiten pro Tag essen, mindestens dreimal wöchentlich mindestens 30 Minuten gehen und ihr Gewicht um 10 Prozent reduzieren. Medikamentös stehen, meist in Kombination mit Metformin, Acarbose (vor allem im frühen Diabetesstadium), DPP-4-Hemmer, GLP-1-Analoga, Glinide und prandiales Insulin zur Verfügung. Der Diabetologe riet wegen des hohen Hypoglykämierisikos von Sulfonylharnstoffen ab. (bmg)
Mehr zum Thema Diabetes
14.02.2012 l PZ
Foto: Fotolia/Poprocki