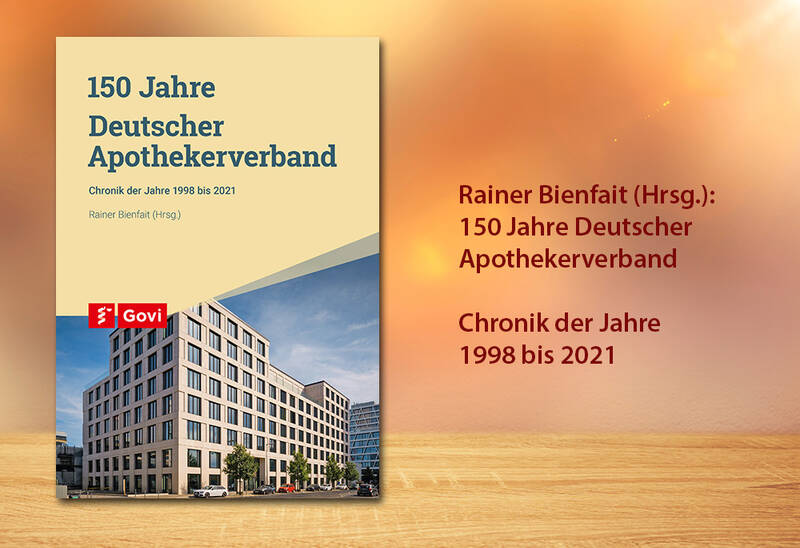Literatur
(1) Friedrich, C.; Müller-Jahncke, W.-D.: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Eschborn, Govi 2005 (Geschichte der Pharmazie/R. Schmitz. 2), S. 785-792.
(2) Staiger, C.: Schlaglichter aus der Geschichte: 125 Jahre Deutscher Apothekerverband. Pharm. Ztg. 142 (1997), 3138 (recte: 3187)-3195. Zu Daten der Vereinsgeschichte vgl. insbesondere Dilg, P.; Esser, E.: Kompetenz und Tradition: Chronik zum 125jährigen Bestehen des Deutschen Apotheker-Verbandes: 1872–1997. Eschborn, Govi, 1998.
(3) Zu Leben und Werk siehe Grebe, K.: Heinrich Salzmann (1849–1945): Leben und Leistung eines pharmazeutischen Standespolitikers. Eschborn: Govi 2016.
(4) Meyer, H.: Deutscher Apotheker-Verein – 100. Geburtstag. 3. bis 5. September 1972. Überlegungen, Betrachtungen und Erinnerungen. Pharm. Ztg. 117 (1972), 1285–1292; 1317–1324; 1368–1377.